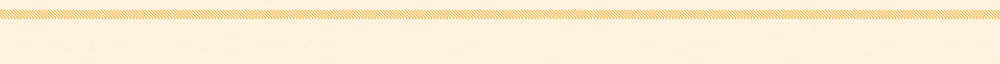Biographisches über Wilhelm Schnepf
Von Werner Christian Simonis
Publiziert in: Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Weihnachten 1954, S.172-77. Wilhelm Schnepf
Wilhelm Schnepf* 9. April 1880 zu Altkirch im Elsaß – t 12. Juli 1954 zu Freiburg i. Br.
Unerwartet, mitten aus seinem unermüdlichen Schaffen auf seinen Lieblingsgebieten herausgerissen wurde Wilhelm Schnepf in der Frühe des 12. Juli 1954, nachdem er noch am Nachmittag vorher wie seit fast 30 Jahren für die Weleda Heilpflanzen gesucht hatte. Er war ein echtes Kind des Elsaß, wo er, im Zeichen des Widder geboren, zu Altkirch der Sohn des dortigen evangelischen Pfarrers wurde, als ältester Bub unter sechs Geschwistern. Viermal vollendete der Mondknoten seinen Umlauf, ehe er Wilhelm Schnepf den Weg in die geistige Welt frei gab. Schnepfs Erdenweg durch diese vier Umläufe war ein buntes und vielgestaltiges Bild, in dem sich unendliche Weiten vergangener Entwicklungen spiegelten, in dem sich merkwürdige Krisen abspielten. Die Mutter war ihm sehr früh gestorben, so dass die sechs Kinder unter der Obhut der als Haushälterin fungierenden Köchin aufwuchsen. Der Vater, ein gewaltiger Choleriker, war in seinen jungen Jahren als Missionar in den Tropen, besonders in Indien gewesen, hatte sich dort ein schweres, chronisches Leberleiden zugezogen, was auf seine Temperamentslage bestärkend einwirkte, sehr zum Leide und Schaden von Wilhelm Schnepf.
Auffällig an ihm war seine Liebe zur Natur, der er sich bereist in ganz jungen Jahren bewusst hingab. Alles, was er tat, war auf die Natur ausgerichtet, und alles, was in der Schule mit Naturerkenntnissen zusammenhing, zählte zu seinen Lieblingsfächern. Er besuchte in seiner Heimatstadt das Gymnasium, dem er auf Grund seiner Veranlagung und der späteren Erfahrungen immer mit skeptischen Gefühlen gegenüberstand. In frühen Jahren – so erinnerte er – hatte er noch das Erleben der Elementarwesen gehabt, was spätere Erlebnisse weitgehend erklärt. Mit sieben Jahren lag er einmal auf einer Wiese und hatte in den Himmel gestarrt, als ihm dieser plötzlich wie lauter Punkte erschienen war und er in seinem Bewusstsein die Gewissheit hatte: „Ich werde niemals sterben!“
Das Schauen in den Himmel war nicht nur in so müßiger Weise seine Lieblingsbeschäftigung; mit unendlicher Begeisterung lebte er auch mit den Schmetterlingen, die er aber in nie versiegender kindlicher Weise unbedingt alle in seinen Sammelkästen haben musste. Wann immer er konnte, ging er hinaus auf Schmetterlingsfang. Ein Gymnasium mit seiner grundsätzlichen Ausrichtung auf das Altertum hatte natürlich nicht viel Verständnis für solche Leidenschaften; so war Wilhelm Schnepf gerade der Nachmittagsunterricht ein arges Hindernis. Eines Tages bot sich dem geknechteten Geist eine Chance. Ein neuer Lehrer, der die Kinder mit ihren Verhältnissen noch nicht kannte, wurde das Opfer der Schmetterlinge, Schnepf ging zu dem „Neuen“: „Herr Lehrer, ich bitte um schulfrei für heute nachmittag; ich muss meinem Vater Kühe hüten helfen!“ Die Bitte wurde gewährt, und Wilhelm Schnepf zog zu den Seinen. Am Spätnachmittag wurde der neue Lehrer erstmalig dem Lehrerkollegium und dem evangelischen Pfarrer vorgestellt. Als der Name Schnepf fiel, erinnerte sich der Lehrer an den Schüler und sagte zu dem Pfarrer: „Ich habe ja auch einen Schnepf in der Klasse; der ist aber wohl nicht mit Ihnen verwandt. Er hat sich heute frei geben lassen, um seinem Vater Kühe hüten zu helfen!“ Man kann sich vorstellen, welcher Orkan in dem alten Schnepf, der bisher nur mit Schafen zu tun hatte, getobt hat, welche Prügel der junge Schnepf bezog, bis die alte Köchin energisch Einhalt gebot.- Die Cholerik des Vaters, das Starre der Schule, von der er oft Strafzettel mit heim brachte, denen dann stets die Prügel des Vaters folgten, diese unverständigen Zusammenhänge, denen heutige Schüler durch die Waldorfpädagogik ja entzogen sind, ließen in Wilhelm Schnepf eines Tages den entscheidenden Entschluss reifen: er wollte Kuhjunge in der Schweiz werden! Eines Nachmittags nach der Schule warf er seine Schulbücher ihrem Wesen gemäß in die Kalkgrube und ging nicht mehr heim. Der Versuch, im Bahnhofswartesaal zu übernachten, scheiterte zwar, so dass die erste Nacht noch der väterliche Obstbaum als Quartier dienen musste. Ganz früh am Morgen ging er dann zum Bäcker und Fleischer, wo der Pfarrer die Rechnungen „anschreiben“ ließ, versorgte sich mit Brot und Wurst und zog in Richtung auf die Schweizer Grenze. Mancher Fuhrmann nahm ihn mit. Nachmittags war er in Bourg angekommen, kehrte in einem Gasthaus ein, in dem er schon öfter mit dem Vater gewesen war und erzählte den Wirtsleuten, sein Vater würde ihn dort abholen. Ein Tag verging, ein zweiter Tag verging, die Wirtsleute wurden stutzig, da kam ein Telegramm: „Ist mein Sohn Willi dort?“- Wilhelm Schnepf wurde auf die nächste Postkutsche gesetzt, mit zehn Mark versehen und heimwärts geschickt. Während der „Schwager“ seine Weisen auf dem Horn blies, sprang Wilhelm wieder aus dem schaukelnden Wagen und verschwand im Walde. Wieder wandte er sich in Richtung auf die Schweizer Grenze; nun hatte er noch dazu Geld in der Tasche. Die Nacht wurde unheimlich. Das Übernachten in einer Burgruine wurde wegen mancher unheimlicher Begleitumstände aufgegeben. Ein Heuschober diente für den Rest der Nacht als Lager. Am nächsten Tage näherte er sich der Grenze wieder. Es war ungefähr gegenüber Reinach-Aesch bei Dornach. Gegen Abend wanderte er durch den Grenzwald. Ein Grenzer traf ihn, fragte nach Woher und Wohin. „Ich bin der Lehrerssohn von Leymen!“, dann zog Schnepf seiner Wege. Plötzlich rief ihn der Grenzer an, er sollte einmal stehen bleiben. Der Ausreißer hörte aber darauf nicht. Auch die Drohung mit dem Schießen hielt ihn nicht davon ab, sein Tempo zu beschleunigen. Tief in der Nacht kam er an ein Wirtshaus (wie im Märchen), klopfte die Wirtin heraus und bat um ein Nachtquartier. Die Wirtin nahm ihn sehr freundlich auf, bewirtete ihn. Während seiner nächtlichen Mahlzeit erschien wieder ein Grenzer, setzte sich neben Wilhelm Schnepf, unterhielt ihn nach allen Regeln der Kunst, ließ ihn mit seinem Gewehr „pumpen“. Dann brachte die Wirtin ihn auf sein Zimmer, half ihm bei allem und nahm dann die Kleider an sich mit dem Hinweis, sie reinigen zu wollen. Der Protest, dass Schnepf das selber machen wollte, fruchtete nichts. Sie ging hinaus und drehte den Schlüssel in der Tür um. „Jetzt haben sie mich“, dachte der Ausreißer und schlief dabei unbekümmert ein. Dieser Reinfall war das Produkt eines Steckbriefes, den der Vater inzwischen hatte ergehen lassen. Am nächsten Vormittag traf der Vater ein und schloss den Sohn tränenden Auges in seine Arme. Die Heimfahrt wurde für den zwölfjährigen Schnepf eine Triumphfahrt. Ganz Altkirch war auf den Beinen und kam der Postkutsche entgegen. Die Mitschüler empfingen ihn begeistert, wollten ihm alles mögliche schenken und versicherten ihm, dass er von nun an alles von ihnen abschreiben dürfte. Schnepf war der Held des Tages und der Woche, denn nicht weniger als fünf Tage hatte er die Polizei an der Nase herumgeführt, worüber – wie man erzählte – der alte Schnepf heimlich sogar sehr stolz gewesen sein soll. Viele Episoden kennzeichnen die Gymnasienzeit Wilhelm Schnepfs. Nach fünfmaligem Sitzenbleiben zog er durch das Abschlußabitur, das ihm gegeben wurde, „weil er Offizier werden wollte“, endlich diese mittelalterliche Zwangsjacke aus.
Die Offiziersschule in Danzig war das nächste Erziehungsinstitut, das er mit mehr Erfolg und Begeisterung durchmachte. Auf Grund seiner naturbeobachtenden Fähigkeiten wurde besonders das Geländezeichnen sein Steckenpferd und dann das Turnen. Hier war er Meister. Bei einem großen Wetturnen, bei dem sein Konkurrent die Nerven verlor, sprang er über acht Pferde, sowie auch über mehrere Schränke. Der nachmalige Generalfeldmarschall v. Mackensen schenkte ihm für diese Leistungen einen Ehrensäbel mit Damaszenerklinge. - Noch bis in sein 40. Lebensjahr konnte Schnepf aus dem Stand heraus über die Lehne eines Stuhles springen, was ihm selbst Zirkusakrobaten angeblich nicht nachmachen können.- Von Danzig wurde er als Leutnant zur Artillerie nach Straßburg versetzt. Auch Straßburg hatte für den jungen Leutnant manche Episode. Die innere Linie dieser Offizierszeit war bei ihm sehr stark erfüllt von einem Erkenntnisstreben nach den inneren Weltzusammenhängen. So erzählte er, dass ihm in dieser Zeit und auch später noch das Studium des Johannesevangeliums am meisten am Herzen gelegen hatte, das er ständig im Ärmelaufschlag der Uniform bei sich trug. Sein geistiger Gegen- und Mitspieler, ein Leutnant G., mit dem zusammen er den „Faust“ studierte, ging ganz andere Wege als Schnepf. Von der Geistesart Prof. Drews verführt, konnte der den Begründer des Christentums nicht als den Gott im Menschenleibe anerkennen. Unter dem Pseudonym „Fuhrmann“ veröffentlichte dieser Offizier ein Buch: „Christus nur ein Mythos!“- As ein Charakteristikum dieser beiden Schicksale mag Folgendes noch erwähnt werden. Während die Beschäftigung mit dem Johannesevangelium bei Schnepf zu einem Erlebnis führte, das er so schilderte, als sei ihm in Straßburg auf einer Brücke der Christus als Erscheinung begegnet, nahm der Freund und Kamerad G. zu Beginn des Weltkrieges sich durch Erschießen das Leben.
In die Straßburger Zeit fiel auch folgender oft wiederkehrender Traum, der Schnepf stets voll in Erinnerung blieb. Er erwachte im Traum, und es wurde vor ihm – wie auf einem Altare – ein Riesenbuch aufgetan. Alles wirkte wie eine einsame Weihestätte. Die Stimmung war ungemein feierlich. Wilhelm Schnepf sah sich alleine dem Buche gegenüber und las dann: „Das Leben ist der Weg zum Tode – der Tod ist der Weg zum Leben.“ Dann hörte er, wie ein ihm unsichtbares Wesen befahl, hinter sich zu schauen. Dort erblickte er einen kleinen, hässlichen Zwerg. Die Stimme befahl ihm, den Zwerg zu töten, und er fühlte, wie ihm ein Dolch in die Hand gedrückt wurde. Im Blicken der Augen flehte der Zwerg so sehr um sein Leben, dass Schnepf nur mit geschlossenen Augen rückwärts zu stechen vermochte. Er wusste aber niemals, ob er ihn je getroffen hatte.
Eine durchaus andere Straßburger Episode war folgende. Eines Tages hatte Lt. Schnepf die Wache. Was das bedeutet, ist bekannt. Dieses militärische Schauspiel der Garnisonsstädte war für die Offiziere der kaiserlichen Zeit eine der Gelegenheiten zum Feiern, wo abends also Wein und Sekt spendiert werden mußten. Dieses die Grundstimmung folgenden Geschehens. Der Tag der „Wache“-Übernahme durch Lt. Schnepf war der Todestag Papst Leos XIII.. Im katholischen Straßburg war alles weiß-gelb geflaggt. Der Tambourmajor fragte den Leutnant, welche Musikstücke er auf dem Marsche zur Wache spielen sollte. Ohne Besinnen befahl Schnepf: „Der Papst lebt herrlich in der Welt“ und den Hohenfriedberger Marsch. So geschah es. Die katholische Bevölkerung wollte die Wache stürmen, bis ein höherer Offizier erschien, den Wachhabenden im Hintergrunde verschwinden ließ, und die Bevölkerung beruhigte. Am folgenden Tag musste Lt. Schnepf in Paradeuniform vor dem Militärgericht erscheinen. Der leitende Gerichtsoffizier bekam über die Angelegenheit einen solchen Lachkrampf, dass er das ganze Verfahren unter den Tisch fallen ließ. Als letztes Erlebnis der Straßburger Zeit mag noch folgende Begebenheit erwähnt sein: Nach dem Dienst kommt Lt. Schnepf eines Mittags müde auf sein Zimmer in den Kasematten der Festung. Mit voller Uniform legt er sich auf sein Bett und schläft ein. Plötzlich wird er sich voll klar bewusst, dass er aufwacht und aufsteht. Er sieht dann seinen Körper in Uniform schlafend auf dem Bette liegen. Er wendet sich zu dem Tisch im Zimmer, auf dem aufgeschlagen das Parolebuch liegt. Er liest darin. Als er sich darauf umwendet und zu dem Kameraden ins Nachbarzimmer gehen will, wundert er sich, dass er einfach ohne Mühe durch die Wand zu gehen vermag. Der Kamerad, ein Oberleutnant Schw., bemerkt ihn nicht. Er arbeitet an seinem Schreibtisch an einer Erfindung, einem Artilleriegeschoßzünder, dessen Einzelheiten Schnepf genau aufgezeichnet vorfindet. Vor dem Oberleutnant sitzt eine Katze. Vergeblich versucht Schnepf sich ihm bemerkbar zu machen, er bläst ihn an. Nur das Kätzchen weicht etwas zurück. Dann geht Schnepf wieder in sein Zimmer zurück, sieht sich dort wie vorher auf dem Bette liegen. Dann geht er durch das Fenster auf die Straße. Von dort gelangt er ohne Schwierigkeiten in den unteren Festungsbereich, wo vollkommen abgeschlossen ein Tunnel für die Eisenbahn gebaut wurde. Er steigt in den Schacht hinab, geht an den Arbeitern vorbei – keiner sieht ihn – er sieht alles!
Darauf kehrt er in sein Zimmer zurück und sieht gerade noch, wie sein Bursche eintritt, an das Fenster stürzt und es aufreißt – dann erwacht er unter der Wucht der Wiederbelebungsversuche, die sein Bursche an ihm machte. Der Bursche hatte den Kanonenofen geheizt gehabt, die Tür nicht richtig geschlossen, so dass Wilhelm Schnepf einer Kohlenmonoxydgasvergiftung ein besonderes leibfreies Erlebnis verdankt.
Nach Berlin versetzt, ließ Schnepf 1905 sich zur Reserve überschreiben. Er wollte nun studieren; doch wurde daraus nie etwas. Mit Gelegenheitsarbeiten musste der Unterhalt verdient werden. Als Teilnehmer an einem Dichterstammtisch lernte Schnepf einen Freund kennen, der ihn an das Statistische Amt brachte. Später kam Schnepf an das Kaiserliche Reichsgesundheitsamt unter Geheimrat Bumm. 1910 heiratete er. 1914 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde der Reserveleutnant sofort eingezogen, nach weiterer Ausbildung zum Oberleutnant befördert und dann an die Ostfront geschickt.
Hier war die Lage so, dass nach der Schlacht bei Tannenberg ziemliche Ruhe an der Front war. Im weiteren Vorfeld der Stadt Kowno war Oblt. Schnepf mit seinem Zuge eingesetzt (alle hundert Meter ein Mann). Der Bursche, der gut russisch sprach, rekognoszierte eines Tages allein das Vorfeld und traf auf einen einsamen russischen Posten, mit dem er sich kameradschaftlich unterhielt und ihm erzählte, welch ein enormer Aufmarsch im Gange wäre, um eine Offensive gegen die Russen zu beginnen. Am nächsten Tage ging Schnepf mit dem Burschen vorsichtig durch den vor der Front liegenden Wald. Nirgends fanden sie einen Russen. Sie schlichen weiter vor, bis sie ein festes Militärlager vor sich sahen. Friedlich lag es da, die Schornsteine qualmten, aber kein Russe war zu sehen. Schließlich wagten die beiden den Vorstoß und eroberten ohne Schuss das verlassene, wohlversorgte Russenlager. Ein oder zwei Tage später machte sich Schnepf wieder mit seinem Burschen auf. Sie marschierten durch den Wald und näherten sich vorsichtig der Stadt Kowno, die vor ihnen lag. Die Vorsicht war überflüssig, denn bei ihrem Erscheinen am Waldrand machte sich ein Zug Menschen von Kowno auf, ging ihnen entgegen. Juden im schwarzen Kaftan trugen ihm den Riesenschlüssel der Stadt entgegen und übergaben dem Oberleutnant Schnepf die Stadt. So eroberte Schnepf Kowno an der Memel. Als er zur Stellung zurückmarschierte, begegnete ihm ein Major mit einem größeren Truppenkontingent, mit dem er Kowno erobern wollte. Oberleutnant Schnepf meldete: „Herr Major, habe soeben Kowno erobert!“ Der Major schnaubte vor Wut. Im abendlichen Heeresbericht heiß es dann: „Oberleutnant Schnepf eroberte im Handstreich die Stadt Kowno.“
Nach kurzer Zeit kam für Schnepf der Einsatz an die Westfront, wo er drei Jahre lang bis zum Kriegsende immer an vorderster Front war. Hundertvier Schlachten hatte er mitgemacht, ohne ein einziges Mal verwundet zu werden. Von ihm ging der Spruch: „Wo der ist, passiert nichts!“
Als Hauptmann und Bataillonskommandeur beendete er den Krieg, der ihn mit der damals typischen Krankheit, der Ruhr, schließlich als ein menschliches Wrack nach Berlin zurückführte. Zwar trat er seinen Dienst im Reichsgesundheitsamt wieder an, doch war die Krankheit so verheerend, dass er mehr fehlte als Dienst machte. Schließlich musste er sich pensionieren lassen. Die Ärzte hatten ihm sein baldiges Ende vorausgesagt. Nun, Wilhelm Schnepf hat diese ärztliche Prognose, wie es ja viele Patienten tun, dreißig Jahre überlebt. Im Jahre 1924 zog er mit seiner Frau nach Freiburg im Breisgau.- Das war in großen Zügen sein äußerer Weg.
Die geschilderten Episoden und viele andere, die hier nicht mehr gebracht werden konnten, sind so typisch, dass sie eigentlich nach dem Höhepunkt rufen. Dieser Höhepunkt kam. An der Westfront traf Schnepf als Hauptmann einen Leutnant in dessen Bunker an, wie er Bücher von Rudolf Steiner las. Er machte sich darüber lustig. Der Leutnant wies den Hauptmann zurecht: „Herr Hauptmann, hier muss ich Ihnen leider widersprechen. Man kann sich erst ein Urteil erlauben, wenn man etwas davon gelesen hat!“- Das Buch „Christentum als mystische Tatsache“ wurde dann das erste anthroposophische Buch, das Schnepf las und ihn restlos zur Kapitulation bereit fand. 1918 traf er dann in Berlin mit Rudolf Steiner zusammen, der ihn in den dortigen Zweig aufnahm und später in die Klasse in Dornach. In Berlin nahm Schnepf an dem regen anthroposophischen Leben teil, war auch dabei, als Dessoir „klein“ gemacht wurde. Der Zweig in Potsdam war eine Gründung von Wilhelm Schnepf.
So interessant und vielgestaltig Schnepfs Erlebnisse vor seiner anthroposophischen Zeit waren, die Anthroposophie wurde erst zur Erfüllung seines Lebens. Ihr blieb er im Irren[?] und im Erkennen immer treu, und für sie setzte er sich mit all seiner Begeisterungsfähigkeit, die nicht gering war, unentwegt ein und führte seine Wege dadurch durch manche bedeutungsvolle Krisen für sich und seine Schicksalsgenossen. Es gab keinen Vortrag, der im anthroposophischen Gesellschaftsleben Freiburgs vor sich ging, an dem Schnepf nicht teilnahm. Sein Teilnehmen hat oft den Vortragenden erst die genügende Zuhörerschaft garantiert, da Schnepf es vermochte, andere, Müdere für eine Sache zu begeistern. Seine Lieblings- und Spezialgebiete des Erkenntnisstrebens wurden selbstverständlich weitgehend durch die Anthroposophie befruchtet. Es waren dies die Botanik und die Schmetterlingskunde.
Im Kreise der stillen Loge der passionierten Schmetterlingssammler und – kenner war Schnepf eine bekannte Persönlichkeit, die im Handeln und Behandeln dieser luftigen Blüten viel Geschick entwickelte. Auf keiner Schmetterlingsbörse in Basel fehlte er. Aber noch ausgiebiger schweifte er äußerlich und innerlich im Bereich der Pflanzenwelt umher, und die Impulse Goethes und Rudolf Steiners fachten seine Liebe zu diesen Naturbereichen derart an, dass er einige wesentliche Entdeckungen machen konnte, die vor allem den Botaniker und Systematiker angehen. Zwei sehr konzentrierte Schriften wurden durch den Schreiber dieses Berichtes herausgegeben. Darüber hinaus fühlte Schnepf sich berufen, eine Gesamtbotanik zu schreiben unter dem Titel „Das Pflanzenreich in seiner Beziehung zu Kosmos, Erde und Mensch“. Als sehr reich bebildertes Manuskript liegen sieben Bände vor und laden ein, gedruckt zu werden.
Mit diesen Tätigkeiten war Schnepfs Lebenswerk nicht erschöpft. Seine wesentlichste Tätigkeit, die weit in die Zukunft hineinreicht, war fraglos seine Sammeltätigkeit für die Weleda. Fast dreißig Jahre lang sammelte er im Elsaß, am Kaiserstuhl und im Schwarzwald die Heilpflanzen für diese und trug dadurch Heilimpulse an jene Menschen heran, die innerhalb und außerhalb der anthroposophischen Bewegung der anthroposophischen Heilkunde ihr Vertrauen schenkten. Viele tausend Ärzte, anthroposophische und nichtanthroposophische, verdanken ihm einwandfreie Arzneipflanzen für die von der Weleda hergestellten Präparate. Was es bedeutet, wenn ein derartig sachkundiger und geistesverbundener Mensch Heilpflanzen sammelt, wird derjenige zu würdigen wissen, der auf die Abfallmedizinen der modernen Pharmazeutik mit dem rechten Urteil zu schauen vermag. Wie Wilhelm Schnepf in seiner Sammeltätigkeit in das gesamte Naturgeschehen eingespannt war, beleuchten zwei Episoden:
Schnepf bekam einmal zu einer verspäteten Jahreszeit von der Weleda den Auftrag, eine bestimmte Menge Herniaria glabra = das
Ein anderes Mal benötigte die Weleda wieder zu einer vorgeschrittenen Zeit eine bestimmte Menge
Noch zwölf Stunden vor seinem plötzlichen Tode ist Wilhelm Schnepf kräutersuchend in Breisach am Kaiserstuhl gewesen. Mit einem Arm voll der wunderbarsten Sommerblumen kehrte er zu seiner Frau heim. Ohne eine solche Blumengabe kam er nie von seinen Streifzügen zurück. Seine eigenen Blumen wurden dann der erste Schmuck seines plötzlichen Totenlagers, auf dem er mit friedlich-zufriedenem Lächeln seine Besucher begrüßte, als wollte er triumphierend sagen (wie im Leben): „Wie hab‘ ich das gemacht?!“
Sein Leben lang war Schnepf äußerlich eine imponierende Erscheinung, seine hohe Gestalt, seine strahlenden, blauen Augen, die veilchenblau vor Begeisterung werden konnten, blieben nie ohne Wirkung auf seine Umgebung. Sein angeborener Humor, der nie ruhende bildreiche Fluß seiner Sprache, in den er, wie ein Freund einmal sagte, „alle Fische der Nordsee in eine Tonne einfing“, alles dies verschaffte ihm einen umfangreichen Freundeskreis, der dieses Gawanschicksal mit Liebe begleitete und verehrte. Er war wirklich eine Gawangestalt, die nun in die Runde des heiligen Grals zurückgekehrt ist.